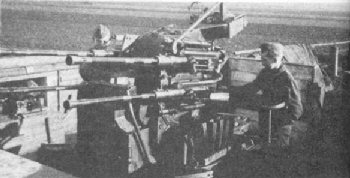Meine Luftwaffenhelferzeit
in einer Flakstellung bei der Sendefunkstelle Norddeich
(Gekürzter
Auszug aus den Lebenserinnerungen von Friedrich Janssen)
| 
Der Verf. als LwH im Jahre
1943
|
Es
war vermutlich im Februar 1943, als in der Schule bekannt wurde, daß
alle Schüler des Jahrgangs 1926 als Luftwaffenhelfer zur Flak eingezogen
werden sollten. In meiner Klasse, der Obersekunda, waren außer mir nur
noch 3 andere Klassenkameraden vom Jahrgang 1926, aber in der Untersekunda
gehörte der überwiegende Teil der Schüler zum Jahrgang 1926.
Einige
Wochen vor unserer Einberufung wurden wir 1926er aus den beiden Klassen
versammelt und der Major Scherer, dem die Flak in Norddeich unterstand,
klärte uns über unseren zukünftigen Einsatz auf: Wir würden an der 2
cm-Flak 38 ausgebildet werden und unser Schutzobjekt würde die Sendefunkstelle
Norddeich sein. Er versprach, uns seinen besten Leutnant als Vorgesetzten
zu geben. Neben dem militärischen Dienst sollten wir weiterhin Oberschulunterricht
erhalten.
Am
29.03.1943 wurden wir als Luftwaffenhelfer (LwH) eingezogen. Wir erhielten
blaugraue Uniformen, mußten allerdings am rechten Ärmel die HJ-Armbinde
tragen. Unsere 6-wöchige Ausbildung begann auf der Insel Norderney.
Wir wurden in eine Kaserne am Rollfeldrand des Fliegerhorstes einquartiert.
Als Ausbildungsoffizier erhielten wir nicht sofort den versprochenen
'besten' Leutnant des Majors Scherer sondern den Leutnant Hohmann.
|
Wir
waren jedoch auch von diesem sehr angetan und konnten uns kaum einen besseren
Offizier vorstellen. Wir
wurden gut behandelt, nicht schikaniert und machten Exerzierdienst, wie er in
der Grundausbildung von Rekruten üblich war, ferner Flugzeugerkennungsdienst,
bei dem wir fast sämtliche alliierten und deutschen Flugzeugtypen kennenlernten,
Waffenkunde und Geschützexerzieren. Da die Luftwaffe auf Norderney nicht über
eine 2 cm-Flak 38 verfügte, wurde das Geschützexerzieren in den Dünen-Stellungen
der Marineflak gemacht. Wir marschierten des Morgens mit Gesang über die Betonstraßen
des Seefliegerhorstes, durch das Norderneyer Wäldchen bis zu den Flakstellungen
der Marine. Schon von weitem hörten wir die Kommandos der übenden Mariner:
Wenn es "Feuer frei!" hieß, rief der Richtkanonier,
so laut er konnte: "Schu....Schu....Schu....Schuß...", bis er durch das neue
Kommando: "Feuerpause" erlöst wurde. Das fanden wir sehr lustig. Sobald wir
die Stellung erreicht hatten, unterbrachen die Marinesoldaten ihre Übungen und
wir kamen dran.
Zu einer Geschützbedienung gehörten vier Mann, die mit
K1 bis K 4 bezeichnet wurden: K 1 war der Richtkanonier. Er saß im Richtkanoniersitz
und bediente die beiden Handräder der Höhen- und der Seitenrichtmaschine, mit
denen er das Rohr heben und senken und die gesamte Kanone drehen konnte. Dabei
schaute er durch das elektrische Visier, mit dem er das gegnerische Flugobjekt
anvisierte. Mit dem rechten Fuß betätigte er den Abzugshebel.
Das E-Visier bestand aus einer halb lichtdurchlässigen
Glasplatte, auf welche ein elektrisch verschiebbares Fadenkreuz eingespiegelt
wurde. Die Glasplatte verschluckte leider relativ viel Licht, so daß man sich
erst eine Weile an die 'Dunkelheit' gewöhnen mußte und auch dann noch das aufzufassende
Flugzeug nur schwer ausmachen konnte. Schaute man jedoch abwechselnd durch das
Visier und wieder am Visier vorbei, um das Flugzeug überhaupt 'hereinzubekommen',
dann bereitete die Umstellung besonders große Schwierigkeiten. Und das alles
mußte ja schnell gehen, sonst war das Flugzeug vorbei, ehe man es aufgefaßt
hatte. Meine Schwierigkeiten waren sicherlich auch auf meine leider recht geringe
Nachtsichtfähigkeit zurückzuführen. Das orange leuchtende Fadenkreuz, dessen
Helligkeit man mit einem Drehknopf einstellen konnte, wurde durch sogenannte
Tachodynamos verschoben:
Je schneller das gegnerische Flugzeug flog, desto schneller mußte der K 1 die Handräder der Richtmaschinen drehen, um das Flugzeug im Fadenkreuz
zu behalten. Desto größere Spannungen lieferten dann aber auch die Tachodynamos
und steuerten das Fadenkreuz in der Weise, daß sich der notwendige Vorhaltewinkel
ergab. Da dieser nicht nur von der Winkelgeschwindigkeit, sondern auch von der
Distanz zwischen dem Geschütz und dem Flugzeug abhängig war, wurden die Entfernungswerte
fortlaufend in die Steuerelektronik eingegeben.
Dies war die Aufgabe des K 2: Er stand hinter dem Geschütz
und stellte an Drehknöpfen auf einem kleinen Schaltpult hinten am Geschütz die
Entfernungswerte ein, die ihm vom E-Meßmann, dem K 3, zugerufen wurden.
Der K 3 stand etwas abseits und stellte mit seinem optischen
Entfernungsmesser, dessen Basis etwa 1 m betrug, die Entfernung des Flugzeuges
fest. Der Ladekanonier, der K 4, stand links vom Geschütz. Seine Haupttätigkeit
bestand darin, das Geschütz mit der vom Geschützführer befohlenen Munition,
die sich in Magazinen mit je 20 Patronen befand, zu ver- bzw. zu entsorgen.
Daneben war er aber auch für das Wechseln heißgeschossener oder beschädigter
Rohre zuständig.
Das Geschützexerzieren begann mit dem Einteilen der
4 Kanoniere. Danach hieß es: "Abzählen!". Die 4 Kanoniere knallten nacheinander
die Hacken zusammen, nahmen Haltung an, meldeten sich laut mit: "K 1", "K 2",
"K 3", "K 4" und rührten wieder. Jetzt war für alle klar, wer welche Funktion
hatte. Da jeder jede Funktion beherrschen mußte, wurde öfter gewechselt. Der
Geschützführer gab die Kommandos: "Wechsellllt ... um!" und "Abzählen!"
Auf das erste Kdo hin sprangen wir umeinander: Der K1
rannte hinten um die Gruppe herum und stellte sich auf den Platz des bisherigen
K 4, dieser sprang auf den Platz des bisherigen K 3 und so fort. Nach dem erneuten
Abzählen rief der Geschützführer: "Fliegeralarm, Flugzeug 10!" Die Kanoniere
2-4 sprangen an ihre Plätze hinter bzw. links neben dem Geschütz, der K 1 schwang
sich in den Richtkanoniersitz und drehte das Geschütz in Richtung 10. Diese
Richtungsbezeichnungen waren der Uhrenskala entnommen: Richtung 12 war Norden,
Richtung 3 Osten, 6 Süden und 9 Westen. Richtung 10 war also West-Nord-West.
Die Richtungen waren am Geschützstand natürlich markiert. Der Richtkanonier
drehte dann noch zum Schein ein bißchen an der Höhenrichtmaschine, blickte angestrengt
in das
E-Visier und meldete: "Ziel erkannt" und eine Sekunde später: "Ziel aufgefaßt".
Soweit ich mich erinnere, hatten in dieser Zeit der K 4, der Ladekanonier, ein
leeres Übungsmagazin eingesetzt, der K 3 die Entfernung des imaginären heranfliegenden
Flugzeuges gemessen und ausgerufen, der K 2 die Entfernung eingestellt und die
Waffe durch Zurückziehen der Verschlußkette und Einrastenlassen des Verschlusses
gespannt.
Der Geschützführer rief dann entweder "Feuerstöße" oder
"Dauerfeuer" und die Kanone wurde dem gedachten Flugzeug nachgeführt, bis das
Kommando "Feuerpause" kam. Daraufhin entnahm der K 4 das Magazin, prüfte mit
einer gebogenen Stange, die er seitlich hinten in das Rohr einführte, ob das
Rohr frei war (oder ob noch eine Patrone in demselben steckte) und meldete "Rohr
frei".
Er betätigte einen Sicherungshebel (?) und meldete "Hebel", darauf zog
der K 2 erneut die Spannkette zurück und rief "Kette", dann trat der K 1 mit
dem Ruf "Abzug" auf das Abzugspedal. Der K 2 ließ daraufhin den Verschluß mit
der Spannkette nach vorne in seine Ruhestellung gleiten.
In Wirklichkeit ging das alles blitzschnell vor sich:
Die Meldungen "Rohr frei", "Hebel", "Kette", "Abzug" folgten in Abständen von
Sekundenbruchteilen nacheinander. Dann sprangen die 4 Mann wieder in Linie hinter
das Geschütz, der Geschützführer rief erneut: "Wechsellllt ... um!" und die
Übung wurde mit geänderten Aufgabenpositionen fortgesetzt. Wenn das Rohr 'heiß
geschossen' war, gab der Geschützführer das Kommando: "Rohrwechsel!". Nach dem
Prüfen auf "Rohr frei" wurde das Rohr, vermutlich vom K 4 (?), mit Asbesthandschuhen
gepackt, aus seiner Bajonettverriegelung gedreht, herausgenommen und auf eine
Abkühlungsgabel gelegt.
Dann setzte er ein neues kaltes Rohr ein und meldete
die Durchführung des Rohrwechsels. Das Geschützexerzieren machte uns Spaß, es
kam unserem Spieltrieb entgegen.
Wir bekamen auch die Unterkünfte der Marinesoldaten
in ihren Dünenbunkern zu sehen und waren von dem Komfort, der dort herrschte,
beeindruckt. Es gab sogar gefließte Duschkabinen dort. Einige Male durften wir
auch an dem Mittagessen der Mariner teilnehmen: Das Essen war hervorragend,
noch besser als das in der Kantine des Seefliegerhorstes, wo wir ansonsten zusammen
mit den Seenotfliegern aßen und einmal bis zu fünf, ein besonders hungriger
Kamerad schweißtriefend sogar sieben, Teller Milchsuppe mit Bonbongeschmack
vertilgten.
Das einzige Unangenehme war, daß die Mariner ständig
mit dem feinen Dünensand zu kämpfen hatten, den der Wind durch die kleinsten
Fugen trieb und der ein tägliches Geschützreinigen erforderte, was man an unseren
Übungstagen ganz gerne uns überließ.
Anschließend ging 's, natürlich wieder mit Gesang,
zurück in unsere Unterkünfte auf dem Fliegerhorst. Nachmittags wurde vorwiegend
unterrichtet. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich und zu diesem Zeitpunkt mußten
wir in unseren 2-stöckigen Betten liegen. Nur der zum Stubendienst eingeteilte
Kamerad mußte aufbleiben und dem Unteroffizier, der den allabendlichen Stubendurchgang
machte, die Stube 'melden'.
Der ziemlich unmilitärischer Kamerad L. C. war häufig
Zielscheibe des Übermuts einiger Kameraden. Eines Tages hatte man ihm aus seinem
oben gelegenen Bett fast alle Bretter, auf denen der Strohsack lag, entfernt.
Sein Untermann hatte sich frühzeitig hingelegt.
Er schlief bereits, als L. sich
anschickte, in sein Bett zu klettern. Als er sich oben über die Bettkante auf
den Strohsack wälzte, brachen im selben Augenblick auch schon die wenigen noch
vorhandenen Bretter und L. fiel mit den zersplitternden Brettern und dem Strohsack
auf den schlafenden Untermann. Dieser fuhr erschrocken aus dem Schlaf hoch und
prügelte im Verkennen der Situation wütend auf den L. ein. Die Stube brüllte
vor Vergnügen.
In der Ausbildungszeit mußte ich einmal zusammen mit
einem Kameraden nach Oldenburg zu einer Wehrmachtsdienststelle fahren, den Grund
weiß ich nicht mehr. Als wir mit dem Dampfer von Norderney nach Norddeich fuhren,
sahen wir einen Luftkampf zwischen einem deutschen und einem englischen Flugzeug,
bei dem die von hinten und oben angreifende Me 109 einen Treffer erhielt und,
hinter dem Engländer in der eingeschlagenen Angriffsrichtung weiterfliegend,
ins Meer stürzte.
Als wir auf der Rückfahrt von Oldenburg wieder in Norddeich
eintrafen, fuhr wegen eines heftigen Frühjahrssturms kein Dampfer und wir mußten
mit der Passage auf einem Versorgungsschiff, der Frisia XIV, vorliebnehmen.
Wir hielten uns mit dem Kapitän, dem Steuermann und einem Matrosen im Steuerhaus
auf. Die drei Seebären qualmten mit ihren Tabakspfeifen um die Wette, während
das Schiff von einem Wellenberg in das nächste Wellental sauste und dabei kräftig
schaukelte. Nach einer Weile wurde ich richtig seekrank von der Schaukelei und
der schlechten, mit Tabaksrauch und Öldunst geschwängerten Luft im Steuerhaus.
Ich ging daher trotz Sturm und Regen ins Freie und konnte so das Erbrechen vermeiden.
Am 01.12.99 freute ich mich über ein Wiedersehen mit
der Frisia XIV: Im Kurier fand ich ein Bild von diesem im Jahre 1939 gebauten
Frachtschiff, wie es im Greetsieler Hafen im Winterquartier liegt. In den letzten
Jahren diente es in den Sommermonaten im Juister Hafen als schwimmender Anlegerplatz
für das Ausflugschiff ''Wappen von Juist''.
| Hier
muß ich noch eine weitere Erinnerung einflechten: Die Wehrmacht veranstaltete
damals alljährlich im Frühjahr den sogenannten "Tag der Wehrmacht".
Im Jahre 1941 fand dieser am 23./24.03. statt. Wir sind im Jahr 1943
am 29.03. LwH geworden. Vielleicht ist der "Tag der Wehrmacht" in diesem
Jahr einige Wochen später begangen worden, denn ich weiß noch ganz sicher,
daß wir Luftwaffenhelfer im Jahre 1943 - vermutlich am Tag der Wehrmacht
- an einem der zahlreichen Aufmärsche, wie sie an solchen Tagen unter
Teilnahme von Verbänden der Partei, der Hitlerjugend und der Wehrmacht
stattfanden, mitmarschierten. Wir waren ein bißchen stolz, als wir danach
von Zuschauern hörten, daß sich unsere Einheit wegen ihrer tadellosen
Marschordnung vorbildlich von anderen Einheiten, vor allem von der Norder
Hitlerjugend, abgehoben hatte. Ich erinnere mich auch noch, daß an einem
dieser Tage abends im Deutschen Haus ein Wehrmachts-Orchester, von der
Marine-Stammabteilung in Tidofeld (?), einen Musikabend veranstaltete,
an dem ich mit einigen Kameraden teilnehmen durfte. Besonders hingerissen
waren wir von "Weekend". Sogar O. W., von dem ich am wenigsten eine
Begeisterung für die damalige Schlagermusik erwartet hätte, sprang während
dieser Darbietung von seinem Stuhl auf und klatschte begeistert Beifall.
|

|
|
Als
unsere Ausbildung Mitte Mai 1943 in Norderney zu Ende war, feierten
wir den Abschluß mit alkoholfreien Getränken in einem Lokal, welches
'Luftbahnhof' genannt wurde und am Rande des Rollfeldes an der Hafenstraße,
nahe dem Ortseingang, lag. |
Der Verf.
zu seiner Dienstzeit bei Norddeich Radio |
Dann gab es noch ein paar Stunden Ausgang. Ich strebte
eiligen Schrittes durch die mir so wohlbekannten Straßen zum großelterlichen
Hause, um meine Tanten zu besuchen. Aber ich war sehr enttäuscht von dem Straßenbild,
welches sich mir bot: Die Straßen waren fast menschenleer und die großen Verandenfenster
der schönen Gästehäuser mit Brettern vernagelt. Ich hatte Norderney noch in
ganz anderer Erinnerung aus Friedenszeiten und nun dieses traurige Bild. Aber meine
Tanten ließen mich diese Tristesse schnell vergessen.
In ihren Wohnräumen fand
ich alles unverändert vor und sie taten alles, um mir den etwa 2-stündigen Besuch
bei ihnen so angenehm wie möglich zu machen. Am nächsten Tag räumten wir unsere
Kaserne und fuhren nach Norddeich in die dort vorbereitete Einsatzstellung.
Leutnant Hohmann verabschiedete sich von uns und wir erhielten jetzt den sagenhaften
'besten Leutnant' des Majors Scherer, den Leutnant Brase, der aus dem niedersächsischen
Visselhövede stammte.
Unsere Stellung lag einige hundert Meter östlich von
der Sendefunkstelle Norddeich, dort, wo der Kugelweg in die Deichstraße mündet.
Zwei Geschützstellungen waren in die Deichkrone hineingebaut worden, das 3.
Geschütz befand sich zunächst etwa 200 m zurück im Hinterland am Weg zum Niemeyerschen
Hof.
Es wurde nach einigen Tagen auf einen Hochstand verlegt,
der im Sumpf an der Deichstraße in der Mitte hinter den ersten beiden Geschützen
auf Pfählen errichtet worden war. Die Baracken der Besatzungen des 1. und 2.
Geschützes waren an die Landseite des Deiches gebaut worden, die Baracke des
3. Geschützes stand auf Pfählen im Sumpf. Von der Baracke führten Laufstege
zur Deichstraße und zum Geschütz-Hochstand.
Wir wurden, wie bei der Wehrmacht üblich, der Größe
nach in 3 Geschützbedienungen, Korporalschaften, aufgeteilt. Korporalschaftsführer
waren reguläre, altgediente Soldaten. Die größten von uns kamen zum 1., die
kleinsten zum 3. Geschütz. Da ich zu den kleineren gehörte, kam ich zunächst
zum 3. Geschütz, in die Korporalschaft des Obergefreiten L., der aus dem Sudetenland
stammte. Wir lagen mit 6-8 Mann in einer Stube. Eines abends las ein Kamerad
aus einem Buch von Ludendorff vor. Plötzlich stockte er, fluchte, warf das Buch
auf die Bettdecke, drehte sich herum, riß das Kopfkissen hoch und entdeckte
darunter ein Mäusenest mit Jungen.
Später gelang es mir, zum 2. Geschütz versetzt zu werden.
Dort bezog ich mit dem Kameraden H.R. eine in die Süd-Ost-Seite des Deiches
gebaute Baracke. Anfangs wohnten wir dort alleine und hatten einen Schlaf- und
einen Wohnraum. Mutter schenkte mir einige unsere alten Gardinen aus der Veranda
und wir richteten uns den Wohnraum ganz wunderschön und zivil ein. H.R. hatte
sein Koffergrammophon und eine Anzahl Schallplatten mit den neuesten Schlagern
mitgebracht und die wurden nun in der Freizeit immer wieder abgespielt. Besonders
gut erinnere ich mich noch an den Schlager 'Blaues Boot', den ich jetzt selber
besitze, nachdem ich ihn vor einigen Jahren aus einer Radiosendung auf Cassette
überspielen konnte.
Führer des 2. Geschützes war der Unteroffizier R., der
sich um ein gutes Verhältnis zu uns bemühte, aber öfter Streit mit Leutnant
Brase hatte. Es hat sogar einmal, was in der Deutschen Wehrmacht ja eigentlich
ein unmögliches Vorkommnis darstellte, das auf gar keinen Fall bekannt werden
durfte, eine Prügelei zwischen den beiden gegeben. Wir hielten den R. in diesem
Fall für den Urheber. Er konnte den jüngeren, ihm aber geistig haushoch überlegenen,
manchen Leuten vielleicht etwas angeberisch erscheinenden Leutnant nicht leiden.
Das 1. Geschütz wurde vom Wachtmeister Sch. geleitet,
der, wie der Obergefreite L., aus dem Sudetenland stammte. Wir amüsierten uns
oft ein wenig über die uns seltsam anmutenden Redewendungen dieser beiden 'Beutedeutschen',
deren Heimat erst vor kurzem aus der Tschechoslowakei in das Großdeutsche Reich
eingegliedert worden war.
Das Verhältnis zwischen den Vorgesetzten und uns war
mit dem Ende der Ausbildung und dem Beginn des Einsatzes schlagartig anders
geworden. Wir wurden mit weniger Strenge, dafür kameradschaftlicher behandelt.
Natürlich war die Autorität der Vorgesetzten in keiner Weise in Frage gestellt,
aber wir merkten doch, daß wir jetzt in einem Boot saßen und im Enstfall aufeinander
angewiesen sein würden. Das war eine ganz neue Erfahrung.
Nun zu unserem Tageslauf: Morgens um 6 Uhr war Wecken.
Nach dem Aufstehen, Anziehen, Frühstücken und Aufklaren fuhren wir kurz nach
7 Uhr mit dem Postbus, der sonst außer einigen Schulkindern und Landleuten nur
die Ablösungen der Dienstschichten der Sendefunkstellen Osterloog und Norddeich
zu befördern hatte, nach Norden zur Schule. Auf der Sendefunkstelle Norddeich
taten einige ältere Marinesoldaten Dienst. Diese übernahmen des Vormittags während
unseres Schulbesuchs unsere Geschütze.
Der Postbus kam von der Sendefunkstelle Norddeich, hielt
vor unserer Stellung, die Marinesoldaten stiegen aus und wir stiegen ein. Nun
war der Bus schon vor halb acht Uhr in Norden und wir konnten noch für fast
eine halbe Stunde nach Hause zu den Eltern gehen, uns noch ein bißchen mit Tee
oder mit Pudding vom Vortag verwöhnen lassen und von unseren Erlebnissen berichten.
Manchmal brachte ich den Eltern und meiner Schwester auch noch etwas zu essen
mit:
Wenn
wir nachts wegen Fliegeralarm über eine bestimmte Zeit hinaus an die Geschütze
mußten, gab es eine Zusatzverpflegung, die zumeist aus fetter Wurst bestand,
die sogenannte 'Alarmzulage'. Viele Kameraden verzichteten darauf. Da es bei
uns zu Hause jedoch ziemlich knapp zuging, wir hatten sonst keine weiteren 'Quellen',
sammelte ich die nicht angenommenen Zulagen ein und brachte sie nach Hause,
wo man sich über die zusätzlichen Lebensmittel freute.
Kurz vor 8 Uhr fuhr ich dann von zu Hause mit dem Fahrrad
zur Schule. Dort erhielten wir einen etwas eingeschränkten Unterricht. Nach
Schulschluß ging 's wieder mit dem Fahrrad nach Hause und sofort im Eiltempo
zu Fuß weiter zur Haltestelle an der Linteler Straße, wo ich in den Postbus
zustieg. Wir fuhren zurück in die Stellung und lösten die Marinesoldaten ab.
Da fällt mir noch ein Erlebnis ein:
Als wir einmal mit dem Bus kurz vor der Stellung an
der Baracke vorbeifuhren, in der die Schreibstube untergebracht war, konnten
wir beobachten, wie der dicke Verwaltungswachtmeister G. auf seinem Schreibtisch
stand und durch das geöffnete Fenster in die Landschaft pinkelte. Wir amüsierten
uns natürlich darüber sehr, aber es hieß dann doch: "So ein Ferkel, wie kann
der uns so vor der mitfahrenden Zivilbevölkerung blamieren!"
Später bekamen wir noch eine Schulbaracke und mußten
nun nicht mehr morgens nach Norden fahren. Statt dessen kamen einige Lehrer
zu uns in die Stellung herausgeradelt und unterrichteten dort. Da sanken aber
Umfang und Niveau des Unterrichts merklich ab.
In der Schulbaracke stand ein
altes Klavier, vermutlich eine Spende aus der Bevölkerung. Es war arg verstimmt
und wenn einer unserer klavierspielenden Kameraden darauf herumhämmerte, klang
es wie die verstimmte Drahtkommode des damals sehr bekannten und beliebten Solisten
Fritz Schulz Reichel, der auch 'Der schräge Otto' genannt wurde.
Auf dem Ofen, der in Schulbaracke stand, brieten wir
uns abends öfter Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Spiegeleiern. So konnten wir
unsere Wohnbaracken frei vom Essensdunst halten. Die Eier kauften wir billig
und in rauen Mengen in der nahe gelegenen Hühnerfarm des Reiner Otten, der bei
der Sendefunkstelle Norddeich als Antennenwart beschäftigt war und sich zum
Nebenerwerb und aus Liebhaberei einige hundert Hühner hielt.
An einigen Vormittagen wurde gelegentlich auch das Geschützexerzieren
geübt, Munition ummagaziniert, Funktions- oder gar Übungsschießen durchgeführt.
Wie sich das mit dem Schulunterricht vertrug, kann ich heute nicht mehr sagen.
Das Ummagazinieren habe ich in schlechter Erinnerung:
Wir hatten 3 Sorten Munition: Die sogenannten Sprenggranatpatronen, die Panzer-
und die Brandmunition. Es gab Magazine, welche mit 20 Patronen eines Typs und
andere, welche mit gemischter Munition gefüllt waren. Wurde eine Änderung der
Mischung angeordnet, z.B. statt '2 Spreng, 1 Panzer' jetzt '1 Spreng, 1 Brand,
1 Panzer', dann mußten wir die Magazine entleeren und anschließend mit der befohlenen
Mischung neu füllen. Das war für uns 16-17 jährige Schüler mit den 'zarten'
Fingern ein hartes Stück Arbeit. Die Patronen saßen unter starkem Federdruck
in den Magazinen und man durfte sie aus naheliegendem Grund nicht etwa mit einem
Hammer herausschlagen sondern mußte sie mit Daumendruck aus dem Magazin herausschieben.
Etwas leichter war es, die leicht eingefetteten Patronen in der befohlenen neuen
Reihenfolge in das leere Magazin einzuschieben.
Manche Kameraden nahmen die Sache allerdings nicht so
ernst und klopften die Munition mit harten Hilfsmitteln aus den Magazinen. Einer
hat sogar einmal versuchsweise eine Patrone mit dem Aufschlagzünder nach unten
aus einem Barackenfenster auf das Straßenpflaster fallen lassen, um seinen Kameraden
zu demonstrieren, daß die Sache 'ganz ungefährlich' sei.
Wir hatten ja im Unterricht gelernt, daß die Munition
nur beim Abschuß aus der Kanone und auch dann erst ca. 2 m nach dem Verlassen
des Rohres scharf wird, wenn sie durch die Züge im Rohr einen 'Drall' bekommen
hat, also in Drehung versetzt worden ist.
Ein anderer Kamerad spannte ein Geschoß in einen Schraubstock
und bog die Patronenhülse hin und her, bis sie sich von der Granate abziehen
ließ. Dann schüttete er die Treibladung aus der Patronenhülse auf ein Stück
Papier und zündete es an, so daß das Pulver verpuffte.
Von solchen Spielereien durften die Vorgesetzten natürlich
nichts merken. Unfälle hat es dabei nicht gegeben. Aber im Waffenkundeunterricht
bekamen wir zu hören, daß bei einer anderen Einheit einmal ein Soldat beim Funktionsschießen
mit scharfer Munition eine Zeitung vor die Mündung des Rohres gehalten habe.
'Eigentlich' sollte die Granate ja erst 2 m nach Verlassen des Rohres scharf
werden. Diese war aber etwas voreilig, explodierte und riß dem Unvorsichtigen
die Hand ab.
Da wir während meiner gesamten Zeit in Norddeich keinen
echten Einsatz hatten, mußte alle paar Wochen ein sogenanntes Funktionsschießen
durchgeführt werden. Das war eine vergnügliche Angelegenheit. Wir versuchten
dabei, mit Einzelfeuer Möven abzuschießen, was uns natürlich nicht gelang, oder
Treibgut zu zerschießen, was schon eher möglich war. Interessant war es, zu
sehen, wie die unter einem flachen Winkel auf die ruhige See aufprallenden Granaten
von der Wasseroberfläche reflektiert wurden und nach dem Gesetz 'Ausfallswinkel
gleich Einfallswinkel' wieder vom Wasser in die Luft stiegen. Trotz der hohen
Geschwindigkeit von etwa 800 m/s, mit der die Granaten flogen, ließ sich ihre
Bahn an Hand der Leuchtspur auch bei Tage verfolgen.
An einem Samstagvormittag ereignete sich ein Zwischenfall
beim Funktionsschießen: Wir hatten Verstärkung durch gleichaltrige Schüler der
Mittelschule, der Gräfin-Theda-Schule, bekommen. Ein paar Tage später war ein
Funktionsschießen angesetzt. Als das 1. und das 2. Geschütz damit fertig waren,
kam die Reihe an das 3. Geschütz, welches bekanntlich auf einem Hochstand im
Sumpf mitten hinter dem 1. und dem 2. Geschütz stand. Wir anderen sahen dem
Geschehen von unseren Ständen aus zu. Der Obergefreite L. vom
3. Geschütz fragte:
"Ist hier jemand, der noch nie geschossen hat?" Es meldeten sich die beiden
Neuen, die Mittelschüler M. und L.
Der L. sollte als erster drankommen und wurde
in den Richtkanoniersitz befohlen. Er war sehr aufgeregt, denn man hatte ihn
ja noch gar nicht richtig ausgebildet, was der Obgfr. L. wohl nicht bedacht
hatte. "Schießen Sie ein ganzes Magazin leer und drehen Sie dabei das Rohr von
0 Grad auf maximalen Erhebungswinkel", rief der Geschützführer und dann: "Dauerfeuer,
Feuer frei!".
L. trat auf den Abzugshebel und drehte aufgeregt an
der Handkurbel der Höhenrichtmaschine, leider in die falsche Richtung. Denn
statt von 0 Grad auf etwa 85 Grad drehte er von 0 Grad auf etwa -15 Grad. Das
hatte fatale Folgen:
Die ersten Schüsse gingen noch über die Deichkrone,
die nächsten ließen das Gras des Deiches zwischen dem 1. und dem 2. Geschütz
hochspritzen und die folgenden die gesamte Nord-West-Brüstung des 3. Geschützes
auseinanderfliegen. In den Nischen der Brüstung standen normalerweise gefüllte
Munitionskisten. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Schüsse in die
Munition hineingegangen wären. Aber durch einen glücklichen Zufall waren gerade
diese Nischen zuvor ausgeräumt worden.
Nun war 'Holland in Not'. Wie üblich beim Kommis, ging
es nun darum, den Zwischenfall zu vertuschen und vor dem Bataillonskommandeur,
Major Scherer, der sich für den Nachmittag zu einer Besichtigung der Stellung
angesagt hatte, geheimzuhalten. In aller Eile fuhr Leutnant Brase zu den Marinesoldaten
bei der Sendefunkstelle Norddeich und bat deren Vorgesetzten um Überlassung
von ein paar Handwerkern unter diesen älteren Soldaten, damit sie unseren zerfetzten
Stand schnellstmöglichst reparierten.
Die Zusammenarbeit klappte, wie erwartet, hervorragend:
Die Marineros rückten mit Brettern, Nägeln, Werkzeug und grüner Farbe an und
bereits mittags war der Stand repariert. Major Scherer hat meines Wissens nichts
von dem peinlichen Vorfall mitbekommen.
Am meisten Spaß machte uns jedoch das gelegentlich durchgeführte
Übungsschießen. Hierbei zog eine gemächlich mit ca. 200 km/h dahinfliegende
W 34, eine einmotorige Junkers-Maschine, an einem langen Seil einen roten Luftsack
hinter sich her, auf den wir dann schossen. Ich erinnere mich noch, daß wir
den Luftsack an einem Vormittag dreimal abgeschossen haben, was nachträglich
kaum zu glauben ist. Vielleicht hat aber auch der Pilot den Luftsack 'losgelassen',
weil ihm unsere Geschosse zu dicht um die Ohren flogen.
Die Nachmittage wurden ausgefüllt mit Geschützexerzieren,
gelegentlichem militärischen Unterricht und Schularbeiten. Zu letzteren kamen
wir aber so gut wie gar nicht, es gab immer wichtigere Dinge zu tun. So mußten
z. B. am Spätnachmittag zwei Mann mit Fahrrädern zu den Frisia-Garagen nach
Norddeich fahren dort die Abendverpflegung in Empfang nehmen und in die Stellung
bringen. Eines der Dienstfahrräder war mit einem zweirädrigen Anhänger versehen,
mit dem die schweren Kaffeekanister transportiert wurden. Außer dem schwarzen
Kaffee, dem 'Muckefuck', wie wir ihn nannten, gab es Kommisbrote, Butter, in
Portionen aufgeteilt, sowie meistens einen großen Suppenteller voller Quark
und einen weiteren voller Marmelade.
Sehnsüchtig
erwarteten wir in der Stellung die Rückkehr der Essenholer. Sehr oft
kam es vor, daß sie wegen Reifenpanne mit großer Verspätung eintrafen.
Die Bereifung der Fahrräder befand sich nämlich in denkbar schlechtestem
Zustand: Das Profil war völlig abgefahren und die Schläuche voller Flickstellen.
Neue Mäntel und Schläuche waren im 4. Kriegsjahr auch für militärischen
Einsatz nicht mehr so leicht zu bekommen. Sobald die Essenholer eintrafen,
stürzten alle, die irgendwie abkömmlich waren, in die Baracke, in der
das Essen verteilt wurde, um die eigene und u. U. die Ration eines guten
Kameraden, der gerade Posten stand oder sonstwie unabkömmlich war, abzuholen.
Es kam öfter vor, daß Abwesende, die keinen Kameraden beauftragt hatten,
bezüglich des Quarks und der Marmelade leer ausgingen, da diese nicht
von vornherein nach der Kopfzahl portioniert geliefert worden waren
und der mit der Verteilung beauftragte Kamerad jedem Anwesenden mit
einem Eßlöffel die Portionen auf die mitgebrachte Untertasse 'haute',
bis die Teller leer waren.
Da
die Flakstellung keine eigene Wasserversorgung hatte, mußte das gesamte
Wasser, welches wir benötigten, von der Sendefunkstelle Norddeich geholt
werden. Wenn also die Kaffeekanister geleert waren, fuhr einer von uns
mit dem Anhängerfahrrad und den Kanistern zur Sendefunkstelle, um Frischwasser
zu holen. Die Sendefunkstelle verfügte über einen Tiefbrunnen und eine
Anlage, in der das harte eisenhaltige Wasser zu Trinkwasser aufbereitet
wurde. An der Außenwand des Maschinenhauses befand sich ein Wasserhahn,
an dem wir jederzeit zapfen konnten. Mehrmals täglich war ein Wasserholer
unterwegs, um den Bedarf der ca. 30 Mann in der Stellung zu decken.
Wenn wir bei unseren Vorgesetzten im Laufe des Tages
unangenehm aufgefallen waren, gab es abends als Sondereinlage auch noch den
sogenannten Maskenball, eine vom Unteroffizierskorps der Deutschen Wehrmacht
sehr gern ausgeübte Erziehungsmaßnahme: Innerhalb weniger Minuten mußten wir
nacheinander in Dienstuniform, Drillichzeug, Sportkleidung, Ausgehuniform auf
der Straße antreten.
Nach jedem Umziehen wurden wir draußen gemustert, ob
wir vorschriftsmäßig angezogen waren. Derweilen prüften andere Unteroffiziere
in unseren Barackenstuben, ob diese sauber und aufgeräumt und die zuvor benutzten
Kleidungsstücke ordentlich in den Spinden abgelegt bzw. aufgehängt worden waren.
Da die ganze Aktion unter hohem Zeitdruck durchgeführt wurde, jedes Umziehen
durfte maximal nur etwa 3 Minuten dauern, gab es selbstverständlich nahezu beliebig
viele Anlässe zu Beanstandungen und Fortsetzungen dieses Schauspiels. Aber schließlich,
wenn die Unteroffiziere sich heiser gebrüllt hatten, fanden auch sie kein Gefallen
mehr an dieser Schikaniererei, wollten ihren Feierabend haben und so kamen auch
wir dann zu demselben. Wir lernten bald, daß es gar keinen Sinn hatte, sich
sonderlich zu beeilen und anzustrengen. Man fuhr besser dabei, wenn man die
Sache etwas gemächlicher angehen und sich nicht bis zur Erschöpfung antreiben
ließ. Die Angelegenheit dauerte dann zwar etwas länger, aber nur wenig, und
man kam insgesamt besser über die Runden. Wir nannten dieses Verhalten, welches
bei den erfahrenen Soldaten gang und gäbe war: 'Auf stur schalten'.
Ab Samstagmittag gab es für einen Teil von uns Wochenendurlaub,
der erst am Montagmorgen um 7 Uhr endete. Wir konnten also etwa alle 3-4 Wochen
einmal ein Wochenende zu Hause verbringen. Die in der Stellung verbliebenen
Geschützbesatzungen hatten an den Sonntagen weitgehend dienstfrei. Da wir uns
im Sommerhalbjahr befanden, wurde viel gebadet. Natürlich durften nicht alle
gleichzeitig ins Wasser gehen, die Geschütze mußten bei jedem Alarm sofort feuerbereit
sein. Bei Ebbe wanderten wir bis an den Fahrwasserpriel und schwammen dort in
dem besonders warmen Wasser, in dem sich so viele Fische tummelten, daß wir
sie öfter mit unseren Beinen berührten. Wir machten auch wohl kleinere Wattwanderungen
und versuchten dabei 'Butt zu pedden'. Hin und wieder gelang es uns, einen Butt
oder eine Scholle zu greifen, die wir uns dann am Abend in der Pfanne brieten.
An schönen Sonntagnachmittagen setzte von Norden aus
eine regelrechte Völkerwanderung zu unserer Stellung ein: Eltern, Geschwister,
Freunde, Freundinnen und Bekannte kamen mit Fahrrädern zur Stellung, saßen mit
uns an der Seeseite des Deiches zwischen den Geschützen und wir aßen die mitgebrachten
Kuchen und tranken Kaffee aus Thermosflaschen, oder tummelten uns gemeinsam
im Wasser. Ein Bild fast wie im tiefsten Frieden, wenn nicht die Geschütze und
die Flugmeldeposten daran erinnert hätten, daß wir uns im Krieg befanden.
An jedem Geschütz mußte Tag und Nacht einer von uns
jeweils für 2 Stunden den Flugmeldeposten wahrnehmen, d. h. ständig mit dem
Fernglas den Horizont und den Himmel nach Flugzeugen absuchen und jedes Flugzeug
über einen Feldfernsprecher der von einem weiteren Kameraden besetzten Vermittlung
melden. Der letztere gab die Meldungen an die Flugmeldezentrale weiter.
Der
Flugmeldeposten löste für die Stellung Fliegeralarm aus, wenn er ein ihm nicht
angekündigtes und nicht sofort einwandfrei als deutsch zu identifizierendes
Flugzeug bemerkte.
Bei Alarm, sei es, daß er von unseren eigenen Posten
oder von der Flugmeldezentrale ausgelöst wurde, unterbrachen wir jegliche andere
Tätigkeit, stülpten uns die Stahlhelme über und besetzten die Geschütze. Wie bereits
erwähnt, sind wir nie zum Einsatz gekommen, was aber nicht heißt, daß wir nicht
feindliche Flugzeuge gesehen hätten. Aber diese flogen gewöhnlich in Höhen über
5000 m und waren somit für unsere 2 cm-Flak 38, welche nur eine Reichweite von
2000 m hatte und ein halbwegs erfolgversprechendes Schießen auf Flugziele nur
bis zu einer Entfernung von ca. 1000 m erlaubte, unerreichbar.
An einem Nachmittag kam eine amerikanische 'Flying Fortress', ein viermotoriger Bomber, mit einem brennenden Motor ziemlich niedrig von Juist her auf die Küste
zugeflogen. Einige hundert Meter vor uns sprangen 4 Mann der ca.
13 Mann starken Besatzung mit Fallschirmen ab und landeten bei Ebbe im Schlick.
Der Bomber passierte die Küstenlinie westlich von uns und eine Me 109 setzte von hinten oben zu einem weiteren Angriff auf ihn an. Der Bomber erwiderte das Feuer aus seinem Heckstand,
stürzte dann aber einige Kilometer landeinwärts ab. Die abgesprungenen Amerikaner wurden von den Marinesoldaten der Sendefunkstelle gefangen genommen. Ein Amerikaner war verwundet. Er hatte
eine Beinverletzung und wurde auf seinem Fallschirm über den Schlick an die Küste geschleppt. Wir staunten, als uns die Marinesoldaten später erzählten, daß die Amerikaner zu stolz gewesen seien, die ihnen von den Soldaten angebotenen
Zigaretten anzunehmen.
Siehe hierzu:
"Bericht des Ostfriesischen Kuriers vom 31.07.1943" |

Amerikanischer B-17-Bomber.
Eine Maschine dieses Typs wurde
Ende Juli 1943 in der Nähe von Norddeich abgeschossen.
|
Nachts sahen wir oft, wie die Flakscheinwerfer auf den
Inseln einzelne Bomber erfaßten und die schweren Zwillingsflakgeschütze auf
Borkum ihre Granaten, die wir an Hand ihrer Leuchtspur mit bloßem Auge mehrere
Sekunden lang verfolgen konnten, in den Himmel schickten.
Wir waren fast ständig müde und unausgeschlafen. Meistens
gingen wir schon gegen 22 Uhr zu Bett. Oft riß uns bereits um 23 Uhr der Fliegeralarm
wieder aus dem Schlaf und wir mußten in Windeseile die Geschütze besetzen und
feuerbereit machen. Wenn dann gegen
1 Uhr nachts Entwarnung gegeben wurde, ging 's wieder in die Betten. Im günstigsten
Falle konnte man dann bis 6 Uhr schlafen, aber wenn man Pech hatte, wurde man
z. B. um 3 Uhr wieder geweckt und mußte bis 5 Uhr Flugmeldeposten stehen. Danach
lohnte es sich kaum, noch einmal ins Bett zu kriechen, denn kaum war man eingeschlafen,
erwachte das Leben in den Baracken und der neue Tag begann mit Aufstehen, Waschen,
Anziehen, Frühstücken, Dienst- oder Schulbetrieb. Beim Unterricht hernach fielen
uns häufig die Köpfe auf Arme und Tische und wir schliefen vor Übermüdung ein.
Dennoch erinnere ich mich gerne an manche frühen Morgenstunden,
in denen ich Flugmeldeposten stehen mußte: Es war ganz neu für mich, die Morgendämmerung
zu erleben. Die Frösche quakten in den Sümpfen hinter dem Deich, die Enten schnatterten
und die Vögel begannen zu singen. Graureiher kamen aus dem Binnenland über den
Deich geflogen und setzten sich auf die Buhnen, die von der aufkommenden Flut
überspült wurden, und fingen sich Fische und anderes Meeresgetier. Und dann
stieg schließlich glutrot die Sonne im Nordosten über den Horizont. All' das
konnte ich mit dem Flakfernrohr in allen Einzelheiten beobachten und genießen
und das ließ mich vorübergehend auch die quälende Müdigkeit vergessen.
Bei schlechtem Wetter hockte man sich nachts auch wohl
in die Fernsprechernische oben auf dem Geschützstand und hielt, was natürlich
verboten war, weil es von der Luftraumbeobachtungstätigkeit ablenkte, ein Schwätzchen
mit dem Kameraden in der Fernsprechvermittlung.
Eines Tages wurden einige Radios, darunter Volksempfänger
VE 301 und DKE 38, letztere waren deutsche Kleinempfänger, auch 'Goebbelsharfen'
oder 'Goebbelsschnauzen' genannt, sowie drei holländische 110V-Philips-Kleinsuper,
in der Stellung verteilt.
Die Kleinsuper waren natürlich begehrt, da sie weitaus
mehr Sender brachten als die Einkreiser, eine bessere Trennschärfe und einen
guten Klang aufwiesen. Leutnant Brase, der sich als erster einen solchen Kleinsuper
genommen hatte, wußte von meinen Kenntnissen der Rundfunktechnik und ließ mich
die Umstellung der Empfänger auf unsere Netzspannung von 220 V vornehmen. Es
wurden mitgelieferte 110-V-Glühlampen zur Herabsetzung der Netzspannung von
220 V auf 110 V hinter den Rückwänden der Empfänger installiert. Als ich mich
auf diese Weise hervorgetan hatte, war es natürlich ein Leichtes für mich, auch
einen solchen Kleinsuper zu ergattern.
Es blieb nicht aus, daß die hervorragenden Wohnverhältnisse,
deren sich H. R. und ich erfreuen konnten, bei den restlichen sechs Mann des
2. Geschützes, die zusammen in einer größeren Baracke wohnten, nicht gerade
mit viel Symphatie betrachtet wurden. Wir hatten zwar fast ständig Besucher,
die sich bei uns einmal wieder in relativ ziviler Umgebung wohlfühlen wollten,
aber es blieb uns nicht verborgen, daß manche uns mit Neid und Mißgunst betrachteten.
Als dann einige Wochen später, wie bereits erwähnt, gleichaltrige Schüler der
Gräfin-Theda-Schule, zu uns stießen, wurden zwei von diesen in unsere unterbelegte
Baracke einquartiert. Wir hatten Glück, es waren Jungens, mit denen wir uns
sehr gut verstanden. Beide kamen vom Land. Der große schlanke H. G. stammte
aus Visquard. Er schwebte über den Dingen, sprach ganz gewählt und schien sich
gedanklich fortwährend mit den großen deutschen Dichtern und Denkern zu beschäftigen.
Der andere war ein Bauernsohn, der mit beiden Füßen im Leben stand und häufig
mit seinen Jagderlebnissen prahlte. Als ich auf sein vermutliches Jägerlatein
etwas ungläubig reagierte, versprach er, mir vom nächsten Wochenendurlaub einen
Fasan mitzubringen.
Ich hatte diese Bemerkung nicht ganz ernst genommen
und schon fast vergessen. Da wurde eines Montags morgens die Barackentür zu
unserem Schlafraum aufgerissen und als ich schlaftrunken hochfuhr, sah ich in
hohem Bogen einen Gegenstand auf mein Bett fliegen.
Der Kamerad hatte sein Versprechen
wahr gemacht und mir einen von ihm geschossenen Fasan mitgebracht und von der
Tür aus zugeworfen. Den hab' ich dann mit nach Haus genommen und ihn zusammen
mit Vater, Mutter und Schwester am folgenden Sonntag verzehrt.
Am 17. August 1943 erließ der Reichsjugendführer Arthur
Axmann einen Aufruf zur Erfassung aller hochfrequenztechnisch interessierten
und vorgebildeten Hitlerjungen. Dieser wurde bei der Hitlerjugend, in den Oberschulen
und in den Stellungen der Luftwaffenhelfer verteilt. So bekamen auch wir LwH
(Luftwaffenhelfer) in der Stellung Norddeich den Aufruf und die Erfassungsformblätter
in die Hände.
Ich war sofort begeistert, eröffnete sich mir doch hiermit
die wunderbare Chance, trotz des Krieges meine Weiterbildung auf dem Gebiet
der Hochfrequenztechnik betreiben zu können. Meine Eltern stimmten freudig zu,
ich füllte ein Formblatt aus und gab es in der Dienststelle zur Weiterleitung
ab. Kamerad E. A., der ebenfalls Interesse an der Hochfrequenztechnik hatte,
tat dasselbe. Wir hatten mit unseren Bewerbungen Erfolg und erhielten um den
17.10.43 herum unsere Einberufungen zu einem Auswahllehrgang zum 1. Sonderlehrgang
für Hochfrequenztechnik in das Reichsausbildungslager 4, auf dem Stegskopf,
bei Daaden/Sieg. Wir sollten uns spätestens am 23.10.43, 14 Uhr, an der Bahnstation
Scheuerfeld an der Sieg einfinden.
Am 21.10.43 durften wir die Flakstellung verlassen.
Wir verabschiedeten uns von den Vorgesetzten und den Kameraden und konnten noch
einmal zu Hause übernachten. Die Eltern versorgten uns mit reichlich Proviant
und Wäsche und dann fuhren wir am 22.10., immer noch als Luftwaffenhelfer und
in unseren LwH-Uniformen, mit der Bahn in Richtung Scheuerfeld in eine ungewisse,
aber hoffentlich erlebnis- und erfolgreiche Zukunft.
Mit einigen Kameraden in der Norddeicher Flakstellung
führte ich noch einige Monate lang einen regen Schriftwechsel. Ich erfuhr z.B.,
daß die Kameraden französische Gewehre bekommen hatten und damit Schießübungen
machten und dann, fast wörtlich:
"Als wir anstelle der bisherigen einrohrigen 2cm-Flak-38
nunmehr Vierlinge (= 4 im Quadrat zu einem Geschütz vereinigte 2-cm-Flak 38)
bekommen hatten, ist eine Waffe ganz auseinandergeflogen. Das Rohr lag hinten im Watt, das Bodenstück im Sumpf auf der Landseite und von der Waffe war nichts mehr zu gebrauchen. Wir war es
dazu gekommen? Beim 1. Geschütz standen wir grundsätzlich mit 3 Mann ständig feuerbereit. Das bedeutete, daß auch mit 20 Granaten bestückte Magazine 'eingeschwenkt' waren. Nun machten die Kameraden beim Waffenreinigen Rohrwechsel, ohne die Magazine zu
entnehmen. |
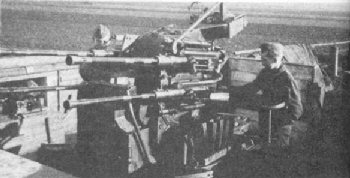
2-cm-Vierlingsflak
Dieses Modell wurde ab Herbst 1943 bei der Sendefunkstelle Norddeich eingesetzt.
|
Ein eingesetztes Rohr 'stakte sich',
die Kameraden stießen mit Gewalt nach und schon ging die Hölle los. Die haben
wahnsinniges Glück gehabt, daß niemand zu Schaden kam.
Das weitere fand sich
dann: Du kannst Dir denken, wie der alte Scherer loslegte. Da war zum zweiten
Mal die Hölle los. Der (noch neue) Geschützführer, ein Unteroffizier, erhielt
4 Tage Bau und wurde versetzt."

Der Verfasser 2004
|
Bis zu welchem Zeitpunkt Luftwaffenhelfer die Stellung
Sendefunkstelle Norddeich 'gehalten' haben, das weiß ich nicht. Unser Schriftwechsel
ist in den Wirren der letzten Kriegsmonate abgerissen. Aber eine wundersame
Begebenheit möchte ich noch nachliefern:
Im Juli 1945 kam ich aus der Gefangenschaft zurück nach
Haus nach Norden. Später, war es noch im selben oder erst im darauffolgenden
Jahr(?), traf ich auf dem Neuen Weg meinen Stellungskameraden H.R. wieder. Wir
beschlossen, per Fahrrad unsere alte Wirkungsstätte, den Ort, an dem unsere
LwH-Stellung gestanden hatte, noch einmal aufzusuchen, um in Erinnerungen zu
schwelgen.
Von der Stellung war nichts mehr zu sehen. Wir fanden
nur noch einen in die Deichkrone eingelassenen, zugeschütteten Zementring, ein
sogenanntes Einmannloch, welches bei Bombenangriffen Schutz bieten sollte. Aber,
wer saß denn dort unten im Gras vor der Basaltkante und schaute auf das Meer
hinaus? Der Mann kam uns bekannt vor. Man mag es glauben oder nicht: Es war
der ehemalige beste Leutnant des Majors Scherer, unser aus Visselhövede stammende
früherer Stellungskommandant Leutnant Brase, der uns so wohlgesonnen gewesen
war, jetzt natürlich in Zivil. Auch den hatte am selben Tag der Wunsch, noch
einmal den Ort seines damaligen Wirkens aufzusuchen, hierher getrieben. Das
gab ein Riesenerstaunen und ein frohes Wiedersehen. Wir hatten uns eine Menge
zu erzählen........
|